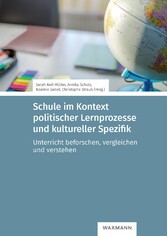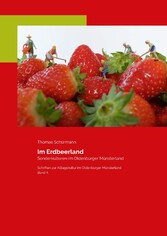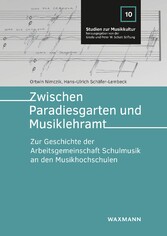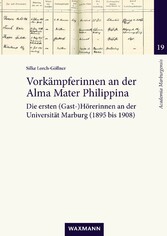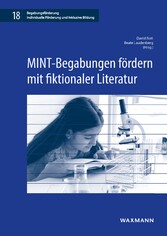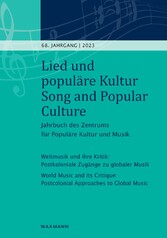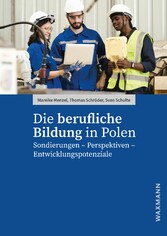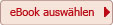Willkommen im eBook-Shop des Waxmann Verlags
Waxmann ist ein international arbeitender Wissenschaftsverlag mit Sitzen in Münster und New York, der sich auf die Veröffentlichung qualitativ hochwertiger Monographien, Sammelbände, Buchreihen und Zeitschriften aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen spezialisiert hat. Unsere Schwerpunkte liegen u.a. in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften wie etwa Psychologie, Soziologie, Volkskunde, Musik- und Literaturwissenschaften, Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, was auch die Evaluation erziehungswissenschaftlicher Theorie und Praxis umfasst. Der Verlag hat derzeit mehr als 2500 lieferbare Titel im Programm.
Unsere Bestseller


Handbuch empirische Forschung in der Pädagogik der frühen Kindheit
Format: PDF, Online Lesen

Format: PDF, Online Lesen

Professionelle Kompetenz von Lehrkräften - Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV
Format: PDF, Online Lesen

Deutsch lehren und lernen - diversitätssensible Vermittlung und Förderung
Format: PDF, Online Lesen
Tipp Wissenschaft
Preis:
30,99 EUR
Dimensionen von Schulentwicklung - Verständnis, Veränderung und Vielfalt eines Phänomens
Tipp Belletristik
Preis:
11,99 EUR
Rotkehlchen - Todkehlchen - Ein Medaillon vom Prinzipalmarkt. Sieglinde Zürichers zehnter Fall
Service
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.